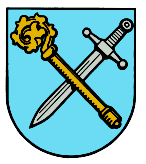
|
|
|
HAUPTSATZUNGder Ortsgemeinde Elsoff vom 1.7.1994Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 der Gemeindeordnung (GemO), der §§ 7 und 8 der Landesverordnung zur Durchführung der Gemeindeordnung (GemODVO), des § 2 der Landesverordnung über die Auswandsentschädigung für Ehrenämter in Gemeinden und Verbandsgemeinden (Entschädigungs-VO-Gemeinden) die folgende Hauptsatzung beschlossen, die hiermit bekanntgemacht wird: § 1 Öffentliche Bekanntmachungen,
Bekanntgaben für den Ortsteil Elsoff: Brunnenplatz für den Ortsteil Mittelhofen: Buswendeplatz (5) Kann wegen eines Naturereignisses oder wegen anderer besonderer Umstände die vorgeschriebene Bekanntmachungsform nicht angewandt werden, so erfolgt in unaufschiebbaren Fällen die öffentliche Bekanntmachung durch öffentlichen Ausruf oder Aushang an den Bekanntmachungstafeln. Die Bekanntmachung ist unverzüglich nach Beseitigung des Hindernisses in der vorgeschriebenen Form nachzuholen, sofern nicht der Inhalt der Bekanntmachung durch Zeitablauf gegenstandslos geworden ist. (6) Sonstige Bekanntmachungen erfolgen gem. Absatz 1, sofern nicht eine andere Bekanntmachungsform vorgeschrieben ist. (7) Die Unterrichtung der Einwohner über die Ergebnisse von Ratssitzungen erfolgt durch Aushang der Niederschriften der Ratssitzungen an den Bekanntmachungstafeln. Die Gemeinde kann zur Unterrichtung der Einwohner ein gemeindeeigenes Mitteilungsblatt herausgeben. § 2 Ausschüsse des Ortsgemeinderates (1) Der Ortsgemeinderat bildet einen Hauptausschuß; der Hauptausschuß hat sieben Mitglieder und für jedes Mitglied einen Stellvertreter. (2) Der Ortsgemeinderat bildet neben dem Hauptausschuß weitere Ausschüsse: 1. Rechnungsprüfungsausschuß 2. Umlegungsausschuß 3. Ausschuß für Öffentlichkeitsarbeit 4. Jugend-, Kultur- und Sozialausschuß (3) Die Ausschüsse gem. Abs. 2 haben folgende Mitglieder und jedes Mitglied einen Stellvertreter: 1.
Rechnungsprüfungsausschuß: drei Mitglieder (4) Die Mitglieder der Ausschüsse werden aus der Mitte des Ortsgemeinderates gewählt. Mit Ausnahme des Rechnungsprüfungsausschusses können die übrigen Ausschüsse auch aus Gemeinderatsmitgliedern und sonstigen wählbaren Bürgerinnen und Bürgern der Ortsgemeinde gebildet werden. Mindestens die Hälfte der Ausschußmitglieder soll Mitglied des Ortsgemeinderates sein; entsprechendes gilt für die Stellvertreter der Ausschußmitglieder. §3 Übertragung von Aufgaben des
Ortsgemeinderates auf Ausschüsse 1. den Haushaltsplan, 2. die Satzungen, 3. die Bauleitplanung, ausgenommen Bebauungspläne, 4. die Finanzplanung. (2) Die Übertragung der Beschlußfassung über eine bestimmte Angelegenheit auf einen Ausschuß erfolgt durch Beschluß des Gemeinderates. Sie gilt bis zum Ende der Wahlzeit des Ortsgemeinderates, soweit ihm die Beschlußfassung nicht entzogen wird. Die Bestimmungen in der Hauptsatzung bleiben unberührt. (3) Dem Hauptausschuß wird die Beschlußfassung über die folgenden Angelegenheiten übertragen: 1. Genehmigung von Verträgen der Ortsgemeinde mit dem Bürgermeister und den Beigeordneten bis zu einer Wertgrenze 500,-- DM, soweit die Beschlußfassung nicht einem anderen Ausschuß übertragen ist; 2. Zustimmung zur Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben bis zu einem Betrag von 5000,-- DM; 3. Verfügung über Ortsgemeindevermögen sowie Hingabe von Darlehen der Ortsgemeinde ab einer Wertgrenze von 2000,-- DM bis zu einem Betrag von 5000,-- DM, soweit die Beschlußfassung nicht einem anderen Ausschuß übertragen worden ist. 4. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten bis 10.000,-- DM, soweit die Entscheidung hierüber nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist. 5. Gewährung von Zuwendungen bis zu einem Betrag von 5000,-- DM, soweit die Entscheidung nicht dem Ortsbürgermeister übertragen worden ist. 6. Stundung und Erlaß von gemeindlichen Forderungen bis 5000,-- DM, soweit die Entscheidung nicht dem Ortsbürgermeister übertragen ist. (4) Dem Ausschuß für Öffentlichkeitsarbeit wird die Beschlußfassung über die Herausgabe und den Inhalt des Mitteilungsblattes übertragen. (5) Dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuß wird die Beschlußfassung über alle Angelegenheiten des Jugendraumes, der Jugendarbeit und des Kulturprogrammes übertragen, soweit die Entscheidung nicht an den Ortsbürgermeister übertragen ist §4 Übertragung von Aufgaben des
Ortsgemeinderates auf den Ortsbürgermeister 1. Verfügung über Ortsgmeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der Ortsgemeinde bis zu einer Wertgrenze von 2000,-- DM im Einzelfall. 2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 3000,-- DM im Einzelfall. 3. Aufnahme von Krediten nach Maßgabe der Entscheidungen des Ortsgemeinderates oder des zuständigen Ausschusses. 4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach Maßgabe allgemeiner Grundsätze und der Richtlinien des Ortsgemeinderates. 5. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 1000,-- DM im Einzelfall, die Niederschlagung gemeindlicher Forderungen und der Erlaß gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 50,-- DM im Einzelfall. 6. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte. 7. Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zu einem Wert von 10000,-- DM im Einzelfall. 8. Einvernehmen in den Fällen des §14 Abs. 2, §19 Abs. 3 Satz 1, §31 und §33 BauGB und in den Fällen des § 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundsätze der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung nicht berührt werden. 9. Zustimmung gem. §21 Abs. 1 Satz 2 i.V.m §20 Abs. 2 Satz 2 GastVO. 10. Entscheidungen über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmittel zur Fristwahrung. 11. Einstellung von Aushilfskräften für Gemeindearbeiten. 12. Einleitung und Fortführung von Gerichtsverfahren sowie der Abschluß von Vergleichen. 13. Entscheidungen und Abschluß von Verträgen im Rahmen des Kulturangebotes der Gemeinde innerhalb der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Zuständigkeit des Ortsbürgermeisters für die laufende Verwaltung gemäß §47 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 GemO bleibt von der vorstehenden Aufgabenübertragung unberührt. §5 Beigeordnete §6 Aufwandsentschädigung des
Ortsbürgermeisters §7 Aufwandsentschädigung der Beigeordneten(1) Der ehrenamtliche Beigeordnete erhält für den Fall der Vertretung des Ortsbürgermeisters gem. §12 Abs. 1 Entschädigungs-VO-Gemeinden eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters. Erfolgt die Vertretung des Ortsbürgermeisters nicht für die Dauer eines vollen Monates, so beträgt sie für jeden Tag der Vertretung ein Dreißigstel des Monatsbetrages der dem Ortsbürgermeister zustehenden Aufwandsentschädigung. Erfolgt die Vertretung während eines kürzeren Zeitraumes als einem vollen Tag, so erhält er ein Sechszigstel der Aufwandsentschädigung nach Satz 2, mindestens 19,60 DM. (2) § 6 Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. §8 Inkrafttreten Elsoff:, den 19.7.1994
Satzung zum Kommunalabgabengesetz (KAG)Ausbaubeitragssatzung "Wiederkehrende Beiträge" der Ortsgemeinde Elsoff vom 29.1.1996Der Gemeinderat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der §§ 2 Abs. 1, 7 und 10 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird: § 1 Erhebung von Ausbaubeiträgen
1. Erneuerung ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einem den regelmäßigen Verkehrsbedürfnissen genügenden Zustand, 2. Erweiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage oder deren Ergänzung durch weitere Teile, 3. Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage, 4. Verbesserung’ sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Änderung der Verkehrsbedeutung i.S. der Hervorhebung des Anliegervorteiles sowie der Beschaf-fenheit und Leistungsfähigkeit einer Anlage. (3)Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen, soweit diese nicht als Erschließungsanlagen im Sinne von § 127 Abs. 2 Bau-GB beitragsfähig sind. (4)Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungsbeiträge nach § 8a BNatSchG zu erheben sind. (5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der Erhebung außer Verhältnis zu dem Ertrag stehen. § 2 Beitragsfähige Verkehrsanlagen
a) bis zu 2 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 12 m, wenn eine beidseitige und mit einer Breite bis zu 9 m, wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist. b) mit 3 oder 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis zu 15 m, wenn eine beidseitige und mit einer Breite bis zu 12 m, wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist, c) mit mehr als 4 Vollgeschossen mit einer Breite bis 18 m, wenn eine beidseitige und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist. 2. Verkehrsanlagen in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten sowie in Sondergebieten mit der Nutzungsart Einkaufszentren, großflächige Handelsbetriebe, Messe-, Ausstellungs-, Kongreß- und Hafengebiet, mit einer Breite bis zu 18 m, wenn eine beidseitige und mit einer Breite bis zu 13 m, wenn eine einseitige Nutzung zulässig ist. 3. Fußwege mit einer Mindestbreite von 1 m bis zu einer
Breite von 5 m. (2) Endet eine Verkehrsanlage mit einem Wendeplatz, so erhöhen sich die in Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 angegebenen Maße um die Hälfte, mindestens aber um 8 m. (3) Ergeben sich nach Abs. 1 unterschiedliche Höchstbreiten, so gilt für die gesamte Verkehrsanlage die größte Breite. (4) Die in Abs. 1 Nrn. 1 bis 4 genannten Breiten sind Durchschnittsbreiten. § 3 Ermittlungsgebiete § 4 Gegenstand der Beitragspflicht
a) für die eine bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzung festgesetzt und eine entsprechende Nutzung zulässig ist, oder b) die, soweit eine bauliche, gewerbliche oder sonstige Nutzung nicht festgesetzt ist, nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen oder gewerblich oder in sonstiger Weise genutzt werden können. §5 Gemeindeanteil Der Gemeindeanteil beträgt 40 % § 6 Beitragsmaßstab 1 In bepflanzten Gebieten die Flache, die der Ermittlung der zulässigen baulichen Nutzung zugrunde zu legen ist. 2 Enthält ein Bebauungsplan nicht die erforderlichen Festsetzungen, sieht er eine andere als die bauliche, gewerbliche oder industrielle Nutzung vor oder liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 Bau-GB), sind zu berücksichtigen: a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser bis zu einer Tiefe von 50 m. b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber durch einen eigenen Weg oder durch einen Zugang, der durch Baulast oder dingliches Recht gesichert ist, verbunden sind, die Fläche zu der Verkehrsanlage hin liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 50 m. Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt. Gehen die Grundstücke über die tiefenmäßige Begrenzung hinaus, sind zusätzlich die Grundflächen baulicher Anlagen zu berücksichtigen, soweit sie zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind. 3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Schwimmbad, Festplatz, Campingplatz oder Friedhof festgesetzt ist, oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 Bau-GB) tatsächlich so genutzt werden, die Grundfläche des im Geltungsbereich des Bebauungsplanes bzw. innerhalb der nach Nr. 2 Buchst. a) und b) ermittelten Tiefenbegrenzung liegenden Grundstückes oder Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. 4. Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 Bau-GB) die Grundfläche der auf dem Grundstück liegenden Baulichkeiten geteilt durch 0,2. 5. Bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 Bau-GB), für die durch Planfeststellung eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung bezieht. (3) Für die Berechnung der Geschoßfläche nach Abs. 1 gilt: 1. In beplanten Gebieten ist die zulässige Geschoßfläche aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes abzuleiten. 2 Hat ein Bebauungsplan den Verfahrensstand des § 33 Bau-GB erreicht, ist dieser maßgebend. 3. Ist statt einer Geschoßflächenzahl nur eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlage festgesetzt, ist sie zur Ermittlung der Geschoßflächenzahl durch 3,5 zu teilen, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- und abgerundet werden. 4. Soweit kein Bebauungsplan besteht oder aus den Festsetzungen des Bebauungsplanes die zulässige Geschoßfläche nicht abzuleiten ist oder keine Baumassenzahl oder zulässige Höhe der baulichen Anlagen festgesetzt ist, gelten für die Berechnung der Geschoßfläche folgende Geschoßflächenzahlen: a) Wochenendhaus- und Kleingartengebiete 0,2
f ) Industrie- und sonstige Sondergebiete 2,4 Als zulässig gilt die auf den Grundstücken in der näheren Umgebung überwiegend vorhandene Zahl der Vollgeschosse oder, soweit Bebauungsplanfestsetzungen für diese Grundstücke erfolgt sind, die dort festgesetzten Vollgeschosse. g) Kann eine Zuordnung zu einem der in Buchstaben a) bis f) genannten Baugebietstypen nicht vorgenommen werden (diffuse Nutzung), wird bei bebauten Grundstücken auf die vorhandene Geschoßfläche, bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken darauf abgestellt, was nach § 34 Bau-GB bei Berücksichtigung des in der näheren Umgebung des Grundstücks vorhandenen Maßes der tatsächlichen Nutzung zulässig ist. h) Ist weder eine Baumassenzahl noch eine Geschoßflächenzahl festgesetzt und die Geschoßflächenzahl nach den Buchstaben a) bis f) nicht berechenbar, wird bei bebauten Grundstücken die Baumasse durch die Grundstücksfläche geteilt. Die sich daraus ergebende Zahl ist zur Ermittlung der Geschoßflächenzahl durch 3,5 zu teilen, wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen auf- und abgerundet werden. 5. Bei Grundstücken, für die der Bebauungsplan a) Gemeindebedarfsflächen ohne Festsetzung einer GFZ oder anderer Werte, anhand derer die Geschoßfläche nach den vorstehenden Regelungen festgestellt werden könnte, vorsieht, b) nur gewerbliche Nutzung ohne Bebauung oder im Verhältnis zur gewerblichen Nutzung untergeordnete Bebauung zuläßt. c) nur Friedhöfe, Freibäder, Sport-, Fest- und Campingplätze sowie sonstige Anlagen, die nach ihrer Zweckbestimmung im <M>wesentlichen nur<D> <D>in einer Ebene genutzt werden können, gestattet, gilt 0,5 als Geschoßflächenzahl. Dies gilt für Grundstücke außerhalb von Bebauungsplangebieten, die entsprechend Buchstabe c) tatsächlich genutzt werden, entsprechend. 6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, gilt die aus den Regelungen des Bebauungsplanes abgeleitete Garagen- oder Stell-platzfläche. Soweit keine Festsetzungen erfolgt sind, gilt 0,5 als Geschoßflächenzahl. 7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach § 4 Abs. 4 und § 7 BauGB-MaßnahmenG liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend angewandt, wie sie bestehen für a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind, b) die ungeplanten Grundstücke, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß enthält. 8. Ist die tatsächliche Geschoßfläche größer als die nach den vorstehenden Regelungen berechnete, so ist diese zugrunde zu legen. - 9. Für Grundstücke im Außenbereich gilt: a ) Liegt ein Grundstück im Außenbereich, bestimmt sich die Geschoßfläche nach der genehmigten oder bei nicht genehmigten aber geduldeten Bauwerken nach · der tatsächlichen Bebauung. b) Für Grundstücke im Außenbereich, bei denen die Bebauung im Verhältnis zu der sonstigen Nutzung untergeordnete Bedeutung hat, gilt 0,5 als Geschoßflächenzahl. Grundstücke, auf denen nur Garagen oder Stellplätze vorhanden sind, werden mit einer Geschoßflächenzahl von 0,5 angesetzt. c) Die Vorschriften der Nrn. 3 und 4 finden entsprechende Anwendung. (4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die Maßstabsdaten nach Abs. 2 um 20 ~ erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten. Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken (gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die Maßstabsdaten um 10 `. (5) Absatz 4 gilt nicht für die Abrechnung selbständiger Grünanlagen. (6) Ergeben sich bei der Ermittlung der beitragspflichtigen Fläche Bruchzahlen, werden diese auf volle Zahlen auf- und abgerundet. § 7 Eckgrundstücke und durchlaufende
Grundstücke § 8 Vorausleistungen § 9 Entstehung des Beitragsanspruches
§ 10 Ablösung des Ausbaubeitrages
§ 11 Beitragsschuldner § 12 Veranlagung und Fälligkeit -
1.die Bezeichnung des Beitrages’, 2. den Namen des Beitragsschuldners, 3. die Bezeichnung des Grundstückes, 4. den zu zahlenden Betrag, 5. die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrundlagen nach dieser Satzung, 6. die Festsetzung des Fälligkeitstermins, 7. die Eröffnung, daß der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und 8. eine Rechtsbehelfsbelehrung. (3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch besonderen Bescheid (Feststellungsbescheid) festgestellt werden. Erhebt die Gemeinde wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen, werden Grundstücke erstmals 15 Jahre nach Entstehung des letzten Anspruchs auf Erschließungsbeiträge nach dem Bau-GB, auf Ausbaubeiträge nach dem bis zum Inkrafttreten dieser Satzung geltenden Kommunalabgabengesetz oder auf einmalige Beiträge nach dieser Satzung beitragspflichtig. § 13 Inkrafttreten Elsoff, den..12.2.1996 Satzung der Ortsgemeinde Elsoff(Westerwald) zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a - 135 c BauGB Auf Grund von § 135 c Baugesetzbuch i.d.F. der Neufassung das Baugesetzbuchs mm 27.08.1997 (BGBl. 1 S. 2141) und von § 24 der Gemeindeordnung für das Land Rheinland Pfalz hat der Gemeinderat der Gemeinde Elsoff (Westerwald) folgende Satzung beschlossen: §1 Erhebung von Kostenerstattungsbeträgen § 2 Umfang der erstattungsfähigen Kosten 1. den Erwerb und die Freilegung der Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Dazu gehört auch der Wert der von der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten
Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung. § 3 Ermittlung der erstattungsfähigen Kosten § 4 Verteilung der erstattungsfähigen Kosten § 5 Anforderung von Vorauszahlungen § 6 Fälligkeit des Kostenerstattungsbetrages § 7 Ablösung § 8 Inkrafttreten Elsoff, den 24.April 1998 Gerz Ortsbürgermeister
Anlage zu § 2 Abs. 3 der Satzung der Gemeinde Elsoff (Westerwalfd) zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a - 135 c BauGB Grundsätze für die Ausgestaltung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1. Anpflanzung/Aussaat von standortheimischen Gehölzen, Kräutern und Gräsern
1.2 Anpflanzung von Gehölzen, freiwachsenden Hecken und Waldmänteln
1.3 Anlage standortgerechter Wälder Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18916 Aufforstung mit standortgerechten Arten 3500 Stück je ha, Pflanzen 3-5jährig Höhe 80-120 cm Erstellung von Schutzeinrichtungen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre 1.4 Schaffung von Streuobstwiesen - Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915 Anpflanzung von Obstbaumhochstämmen und Befestigung der Bäume je 100 qm ein Obstbaum der Sortierung 10112 Einmal Gras-/Kräutermischung Erstellung von Schutzeinrichtungen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre 1.5 Anlage von naturnahen Wiesen und Krautsäumen Schaffung günstiger Wachstumsbedingungen durch Bodenvorbereitung nach DIN 18915 Einsaat von Wiesengräsern und -kräutern, möglichst aus autochtonem Saatgut Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre 2. Schaffung und Renaturierung von Wasserflächen 2.1 Herstellung von Stillgewässern - Aushub und Einbau bzw. Abfuhr das anstehenden Bodens ggf. Abdichtung das Untergrundes Anpflanzung standortheimischer Pflanzen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 3 Jahre 2.2 Renaturierung von Still- und Fließgewässern - Offenlegung und Rückbau von technischen Ufer- und Sohlbefestigungen 3. Begrünung von baulichen Anlagen
3.2 Dachbegrünung intensive Begrünung von Dachflächen extensive Begrünung von Dachflächen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 3 Jahre 4. Entsiegelung und Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung
4.2 Maßnahmen zur Grundwasseranreicherung
5. Maßnahmen zur Extensivierung Nutzungsaufgabe Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 1 Jahr 5.2 Umwandlung von Acker in Ruderafflur
5.3 Umwandlung von Acker in extensiv genutztes Grünland
5.4 Umwandlung von intensivem Grünland in extensiv genutztes Grünland - Nutzungsreduzierung Auslagerung durch Mahd und Verwertung oder Abtransport des Mähguts bei Feuchtgrünland Rückbau von Entwässerungsmaßnahmen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege: 5 Jahre |